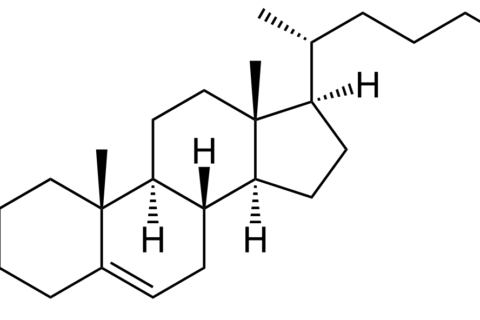Im Patentnichtigkeitsverfahren unterliegen Beschlüsse des Patentgerichts, mit denen über eine Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung entschieden wird, der Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO. § 143 Abs. 3 PatG ist im Nichtigkeitsverfahren nicht entsprechend anwendbar.

Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.
Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde
Die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde ergibt sich allerdings nicht schon aus der Zulassung des Rechtsmittels durch die Vorinstanz. Auch eine zugelassene Rechtsbeschwerde ist als unzulässig zu verwerfen, wenn sie nach dem Gesetz nicht statthaft ist.
Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nach § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO statthaft. Diese Vorschrift ist bei der Kostenfestsetzung im Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG anwendbar.
Gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind im Patentnichtigkeitsverfahren die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren entsprechend anwendbar. Zu diesen Vorschriften gehört § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO. Die darin vorgesehene Rechtsbeschwerde ist auch im Kostenfestsetzungsverfahren statthaft, sofern die Ausgangsentscheidung gemäß § 567 Abs. 2 ZPO der Anfechtung unterliegt und die Vorinstanz das Rechtsmittel zugelassen hat.
Aus § 84 Abs. 2 Satz 3 und § 99 Abs. 2 PatG ergibt sich keine abweichende Beurteilung.
Den genannten Vorschriften ist allerdings zu entnehmen, dass sich die Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung grundsätzlich nicht auf Bestimmungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Patentgerichts erstreckt, sondern dass es insoweit regelmäßig bei den im Patentgesetz selbst vorgesehenen Rechtsmitteln verbleibt. Die ausdrückliche Verweisung in § 84 Abs. 2 Satz 3 PatG soll klarstellen, dass dieser Grundsatz auch bei Kostenentscheidungen gilt.
Entgegen einer in der Literatur verbreiteten Auffassung, die auch von einem NichtigkeitsBundesgerichtshof des Patentgerichts vertreten wird, ergibt sich daraus indes nicht, dass eine Rechtsbeschwerde im Rahmen eines Kostenfestsetzungsverfahrens nicht statthaft ist.
Im Kostenfestsetzungsverfahren kam der Regelung in § 99 Abs. 2 PatG, wonach ein Rechtsmittel nur auf der Grundlage dieses Gesetzes zulässig ist, seit jeher keine Bedeutung zu.
In diesem Bereich war ein Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof nach den bis zum 31.12.2001 geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung generell nicht statthaft.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die einschlägige Regelung in § 567 Abs. 3 und § 568 Abs. 3 ZPO in der bis 31.03.1991 geltenden Fassung (die, soweit hier von Interesse, der Regelung in § 567 Abs. 3 und 4 ZPO in der von 1.04.1991 bis 31.12.2001 geltenden Fassung entspricht), wonach im Kostenfestsetzungsverfahren nach einer Beschwerdeentscheidung eine weitere Beschwerdemöglichkeit nicht statthaft ist, aufgrund der Verweisung in § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG auch in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gilt. Er hat deshalb auch für diese Konstellation, in der das Patentgericht eine Beschwerdeentscheidung trifft, gegen die nach dem Wortlaut von § 100 PatG die Rechtsbeschwerde statthaft wäre, ein Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof als unzulässig angesehen und damit für das Kostenfestsetzungsverfahren trotz des in § 99 Abs. 2 PatG normierten Grundsatzes das Rechtsmittelsystem der Zivilprozessordnung als maßgeblich erachtet.
Der damit auf der Grundlage des früher geltenden Zivilprozessrechts bestehende Gleichklang der Rechtsmittelsysteme im Kostenfestsetzungsverfahren ist auch auf der Grundlage der seit 1.01.2002 geltenden Vorschriften zu wahren.
Im Gebrauchsmusterlöschungs- und im Einspruchsverfahren wäre eine Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren nunmehr schon nach § 100 PatG zulässig, weil die Zivilprozessordnung den Ausschluss dieses Rechtsmittels nicht mehr vorsieht. Für das Patentnichtigkeitsverfahren kann vor diesem Hintergrund nichts anderes gelten. Zwar entspricht es grundsätzlich dem in § 100 Abs. 1 PatG normierten Rechtsmittelsystem des Patentgesetzes, dass eine Rechtsbeschwerde nur gegen Beschlüsse zulässig ist, die das Patentgericht als Beschwerdegericht erlassen hat. Diese Regelung führt aber nicht dazu, dass ein Beschluss des Patentgerichts im Nichtigkeitsverfahren jeder Nachprüfung entzogen ist. Im Regelfall sind solche Beschlüsse vielmehr gemäß § 110 Abs. 6 PatG zusammen mit dem Urteil anfechtbar und unterliegen mithin der Nachprüfung im Berufungsverfahren. Bei einer Entscheidung über eine Erinnerung gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss ist diese Nachprüfungsmöglichkeit nicht eröffnet, weil diese Entscheidungen nach dem Urteil in der Hauptsache ergehen. Weder § 84 Abs. 2 noch § 99 Abs. 2 PatG kann aber der Grundsatz entnommen werden, dass eine Überprüfung des Kostenfestsetzungsbeschlusses in der Rechtsbeschwerdeinstanz in dieser Konstellation schlechthin ausgeschlossen sein soll. Angesichts dessen muss der schon auf der Grundlage des alten Zivilprozessrechts geltende Grundsatz, dass in beiden Konstellationen dieselben Anfechtungsmöglichkeiten bestehen, auch auf der Grundlage des neuen Zivilprozessrechts fortgelten. Deshalb richtet sich die Anfechtbarkeit von Beschlüssen im Kostenfestsetzungsverfahren nunmehr nach § 574 ZPO.
Die – bei der Reform des Zivilprozessrechts unverändert gebliebenen – Regelungen in § 99 Abs. 2 und § 84 Abs. 2 Satz 3 PatG werden durch diese Auslegung nicht obsolet. Ihnen kommt außerhalb des Kostenfestsetzungsverfahrens dieselbe Bedeutung zu wie vor der Reform. Für das Kostenfestsetzungsverfahren kam den Vorschriften aus den genannten Gründen seit jeher keine Bedeutung zu. Auch daran hat sich durch die Reform des Zivilprozessrechts nichts geändert.
Kostenerstattung für den zusätzlich beauftragten Rechtsanwalt
Zu Recht ist das Patentgericht – in Übereinstimmung mit allen anderen Nichtigkeitssenaten – davon ausgegangen, dass § 143 Abs. 3 PatG im Nichtigkeitsverfahren nicht entsprechend anwendbar ist.
Insoweit fehlt es schon an einer planwidrigen Regelungslücke. Weder aus § 143 Abs. 3 PatG noch aus sonstigen Vorschriften ist ein übergreifendes Regelungskonzept des Inhalts zu entnehmen, dass in jedem Rechtsstreit über Bestand oder Rechtsfolgen eines Patents eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt und durch einen Patentanwalt als notwendig anzusehen ist.
Unabhängig davon fehlt es auch an einer vergleichbaren Interessenlage. § 143 Abs. 3 PatG trägt dem Umstand Rechnung, dass in einem Patentverletzungsrechtsstreit die Zuziehung eines Patentanwalts in aller Regel zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung geboten ist, die Parteien aber schon im Hinblick auf § 78 ZPO gehalten sind, auch einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen zu beauftragen. Im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren steht es den Parteien hingegen gemäß § 97 Abs. 1 und 2 PatG frei, ob sie den Rechtsstreit selbst führen oder sich von einem Patentanwalt oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen.
Zu Recht ist das Patentgericht ferner davon ausgegangen, dass bei der Prüfung, ob eine Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO war, grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten ist.
Dieser Grundsatz entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Er trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellten, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind.
Daraus ist allerdings, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend gesehen hat, nicht abzuleiten, dass die Erstattungsfähigkeit bestimmter Kosten für bestimmte Verfahrensarten oder Fallkonstellationen stets gleich zu beurteilen ist. Eine typisierende Betrachtungsweise kommt nur dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. So sieht der Bundesgerichtshof zum Beispiel die Zuziehung eines Patentanwalts bei der außergerichtlichen Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung regelmäßig dann – und nur dann – als notwendig an, wenn hierbei Aufgaben angefallen sind, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören und die von dem mit der Abmahnung betrauten Rechtsanwalt nicht wahrgenommen werden konnten. Die Mitwirkung eines Patentanwalts bei solchen Abmahnungen kann hingegen nicht schon deshalb als typischerweise notwendig angesehen werden, weil die Angelegenheit komplex oder bedeutsam ist. Die Frage, ob eine komplexe oder bedeutsame Angelegenheit vorliegt, entzieht sich nämlich einer typisierenden und generalisierenden Betrachtungsweise.
In der hier zu beurteilenden Konstellation ist eine typisierende Betrachtungsweise – entgegen der Auffassung, die derzeit von zwei Bundesgerichtshofen des Patentgerichts vertreten wird, und in Übereinstimmung mit der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung, die von anderen Bundesgerichtshofen des Patentgerichts geteilt wird, – möglich und geboten. Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.
Die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage stellt an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen.
Eine Partei ist zwar nicht von Rechts wegen gehindert, in den einzelnen Verfahren unterschiedliche Standpunkte zur Auslegung des Streitpatents oder zum Offenbarungsgehalt von Unterlagen, die für die Auslegung oder den Bestand des Schutzrechts von Bedeutung sind, einzunehmen. Dennoch liegt es in aller Regel in ihrem eigenen Interesse, wenn sie ihr Vorbringen in den beiden Verfahren aufeinander abstimmt, also zum Beispiel davon absieht, im einen Verfahren eine enge und im anderen Verfahren eine weite Auslegung des Patents zu postulieren, nur weil dies ihrem Begehren im einzelnen Verfahren vermeintlich förderlich ist. Darüber hinaus haben beide Seiten eine beschränkte Verteidigung nicht nur unter dem Blickwinkel der Zulässigkeit und des Vorliegens von Nichtigkeitsgründen zu prüfen, sondern auch die möglichen Auswirkungen auf den Verletzungsrechtsstreit zu bedenken.
Dieser Abstimmungsbedarf erfordert zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Nichtigkeitsverfahren typischerweise die Mitwirkung derjenigen anwaltlichen Vertreter, die mit der Vertretung der Partei im Verletzungsrechtsstreit betraut sind.
Zwar ist nicht anzunehmen, dass ein Patentanwalt typischerweise nicht in der Lage wäre, die Auswirkungen eines bestimmten Vorbringens oder einer beschränkten Verteidigung des Patents auf den Verletzungsrechtsstreit zuverlässig abzuschätzen. Eine zweckentsprechende Abstimmung der Vorgehensweise in zwei gleichzeitig anhängigen Verfahren erfordert aber nicht nur eine abstrakte Beurteilung der Sach- und Rechtslage. Sie umfasst typischerweise auch die Aufgabe, unter mehreren in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien diejenige auszuwählen, die ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren ermöglicht und für den Ausgang des Rechtsstreits bedeutsame Argumentationslinien nicht ohne Not in Frage stellt. Nicht selten stellt sich zudem die Aufgabe, kurzfristig auf Hinweise eines Gerichts zu reagieren und die möglichen Folgen einer Reaktion für das jeweils andere Verfahren abzuschätzen. Hierzu sind nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, über die ein Patentanwalt und ein in Patentsachen erfahrener Rechtsanwalt häufig in vergleichbarem Maße verfügen, sondern auch die detaillierte Kenntnis der konkreten Verfahrenssituation im jeweils anderen Rechtsstreit und der für den weiteren Verlauf in Betracht kommenden Handlungsalternativen. Wenn diese Aufgaben im Verletzungsrechtsstreit von einem Rechtsanwalt und einem Patentanwalt gemeinsam wahrgenommen werden, entspricht es einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, auch im Nichtigkeitsverfahren beide Vertreter heranzuziehen. Die Beauftragung nur eines Vertreters mit der Maßgabe, dass dieser die erforderliche Abstimmung allein übernehmen soll, ist schon deshalb nicht ausreichend, weil eine Abstimmung naturgemäß die Mitwirkung des anderen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordert.
Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt die Höhe der in Streit stehenden Kosten nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
Die Höhe der geltend gemachten Kosten beruht auf dem vom Patentgericht festgesetzten Streitwert, der mit 2,5 Millionen Euro auch für Patentnichtigkeitsverfahren relativ hoch ist. Der Höhe des Streitwerts kommt bei der typisierenden Betrachtung, ob die Zuziehung eines Rechtsanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung als notwendig anzusehen ist, in der Regel aber keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Insbesondere erschiene es nicht angemessen, die Notwendigkeit gerade deshalb zu verneinen, weil die wirtschaftliche Bedeutung des Rechtsstreits besonders hoch ist.
Die grundsätzliche Erstattungsfähigkeit der Kosten für einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt im Falle eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtsstreits steht nicht in Widerspruch zu der Entscheidung des Gesetzgebers, eine § 143 Abs. 3 PatG entsprechende Regelung für das Nichtigkeitsverfahren nicht vorzusehen.
Dem Umstand, dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich von § 143 Abs. 3 PatG auf den Verletzungsrechtsstreit beschränkt hat, ist allerdings zu entnehmen, dass die Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts im Nichtigkeitsverfahren nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden darf. Diese Rechtsfolge ist mit der grundsätzlichen Anerkennung der Erstattungsfähigkeit im Falle eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtsstreits indes nicht verbunden. Zwar bildet eine Patentverletzungsklage häufig den Anlass und den Hintergrund für eine Patentnichtigkeitsklage. Dennoch gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergeht und in denen auch andere Bundesgerichtshofe des Patentgerichts die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig verneinen.
Zu Recht hat das Patentgericht dem Umstand, dass die Klägerin des Verletzungsrechtsstreits und die Beklagte des Nichtigkeitsverfahrens nicht identisch sind, keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen.
Soweit es wie im Streitfall um die Kosten des Verletzungsbeklagten geht, ist die fehlende Personenidentität auf der Gegenseite schon deshalb unerheblich, weil der an beiden Verfahren beteiligte Verletzungsbeklagte auch in dieser Konstellation typischerweise gehalten ist, sein Vorbringen in den beiden Verfahren aufeinander abzustimmen. Darüber hinaus könnte auch auf der Seite des Berechtigten die Notwendigkeit einer Abstimmung jedenfalls dann typischerweise nicht verneint werden, wenn der Patentinhaber und der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts sich in den beiden Verfahren durch dieselben Anwälte vertreten lassen.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12