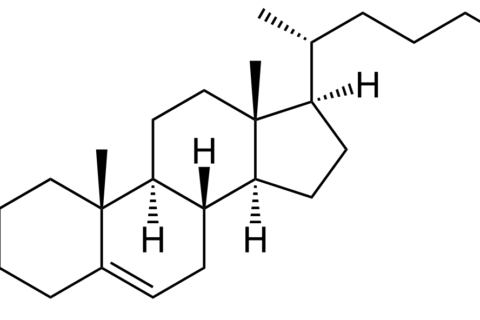Hat der Anmelder Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsgebühr bezahlt, begründet es keinen Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr, wenn die Anmeldung später zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; dies gilt auch dann, wenn die Prüfung der Anmeldung noch nicht aufgenommen worden ist.

Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Patentanmeldung den gesetzlichen Anforderungen genügt, insbesondere ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist. Für einen solchen Prüfungsantrag ist nach § 2 Abs. 1 PatKostG in Verbindung mit Nr. 311 400 des Gebührenverzeichnisses eine Gebühr von 350 € zu entrichten, die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG mit dem Antrag fällig wird und gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 PatG binnen drei Monaten ab Fälligkeit zu zahlen ist. Wird die Prüfungsgebühr – wie hier – durch Erteilung einer Einzugsermächtigung bezahlt, gilt als Zahlungstag nach § 2 Nr. 4 PatKostZV in der Fassung vom 15.10.2003 der Tag des Eingangs der Einzugsermächtigung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Nachdem keine Zweifel an der Wirksamkeit der Patentanmeldung und des Prüfungsantrags bestehen, hat die Antragstellerin mithin am 5.05.2008 die Patentanmeldung eingereicht, Prüfungsantrag gestellt und die Anmelde- und die Prüfungsgebühr bezahlt. Die Antragstellerin hat der Einziehung nicht widersprochen. Daher bedarf es keiner Erörterung, welche Auswirkungen ein solcher Widerspruch und eine dadurch veranlasste Gutschrift des Gebührenbetrags auf dem Konto des Gebührenschuldners hätten.
Eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ist in § 44 Abs. 3 Satz 3 PatG in Verbindung mit § 43 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 PatG nur für den Fall vorgesehen, dass die Gebühr für einen Prüfungsantrag gezahlt wurde, der wegen eines bereits zuvor eingereichten Prüfungsantrags als nicht gestellt gilt. Diese Regelung findet entsprechende Anwendung, wenn die Gebühr für einen Prüfungsantrag entrichtet wurde, der aus anderen Gründen als unwirksam anzusehen ist. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.
Ein Erstattungsanspruch kommt nach § 9 PatKostG für Kosten in Betracht, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären. Die Beurteilung des Patentgerichts, dass eine unrichtige Sachbehandlung hier nicht vorliegt, greift die Rechtsbeschwerde zu Recht nicht an.
Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 PatKostG sind ferner vorausgezahlte Gebühren, die nicht mehr fällig werden können, zu erstatten. Die Antragstellerin hat die Prüfungsgebühr jedoch nicht vorausgezahlt, sondern mit Eintritt der Fälligkeit entrichtet.
Auch einen Anspruch auf Erstattung der geleisteten Prüfungsgebühr nach § 10 Abs. 2 PatKostG verneint der Bundesgerichtshof: Der Wortlaut der Norm macht deutlich, dass diese – anders als § 43 Abs. 4 Satz 3 PatG und § 10 Abs. 1 PatKostG – keinen Anspruch auf Erstattung geleisteter Zahlungen begründet. Sie sieht lediglich vor, dass die Gebühr entfällt, wenn eine Anmeldung oder ein Antrag nach § 6 Abs. 2 PatKostG oder aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen als zurückgenommen gilt oder wenn ein Schutzrecht erlischt, weil die Gebühr nicht oder nicht vollständig bezahlt wurde. Dies steht nach dem letzten Halbsatz des § 10 Abs. 2 PatKostG unter dem Vorbehalt, dass die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde.
Mit der Wendung, dass die Gebühr in einem solchen Fall entfällt, bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass eine bis dahin bestehende und fällige Gebührenforderung, soweit auf sie noch keine Zahlungen geleistet worden sind, mit Wirkung ex nunc erlischt, wenn die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde. Dadurch sollen Vollstreckungsfälle für nach wie vor fällige Gebühren vermieden werden. Zugleich soll sichergestellt werden, dass die Gebühr weiterhin beigetrieben werden kann, wenn das Amt im Vertrauen auf eine eingereichte Einzugsermächtigung bereits Amtshandlungen vorgenommen hat, die nicht von Amts wegen rückgängig gemacht werden können. § 10 Abs. 2 PatKostG erfasst dagegen nicht den Fall, in dem der Anmelder – wie hier – vor Eintritt der Rücknahmefiktion die Prüfungsgebühr bereits gezahlt hat.
Danach ergibt sich ein Anspruch auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr auch nicht aus einem öffentlichrechtlichen Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung von § 812 BGB. Zur Zeit der Zahlung bestand die Gebührenforderung. Dass die Patentanmeldung – nicht der Prüfungsantrag – zu einem späteren Zeitpunkt als zurückgenommen galt, ändert daran nichts.
Für den Fall, dass eine Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, ergibt sich damit aus dem Zusammenhang der gesetzlichen Regelung, dass die Prüfungsgebühr für einen zuvor gestellten Prüfungsantrag mit Wirkung ex nunc entfällt, sofern die Gebühr bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entrichtet und die Prüfung der Anmeldung nach § 44 Abs. 1 PatG noch nicht aufgenommen worden ist. § 10 Abs. 2 Pat-KostG erfasst demgegenüber nicht die Konstellation, dass die Prüfungsgebühr mit oder nach Eintritt der Fälligkeit bereits gezahlt worden ist und die Patentanmeldung zu einem späteren Zeitpunkt zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt. Für diesen Fall sieht das Gesetz eine Erstattung der Gebühr auch dann nicht vor, wenn die beantragte Handlung – das ist hier die Prüfung der Patentanmeldung – noch nicht aufgenommen worden ist. Ob der Patentanmelder, der einen Prüfungsantrag gestellt hat, mit der Prüfungsgebühr belastet wird, wenn die Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt als zurückgenommen gilt, hängt mithin davon ab, ob er zu diesem Zeitpunkt die Gebühr bereits gezahlt hat oder nicht.
Die gesetzliche Regelung hat zur Folge, dass die bereits bezahlte Prüfungsgebühr dem Deutschen Patent- und Markenamt verbleibt, obwohl diese keine Prüfung der Patentanmeldung vorgenommen hat und eine solche auch nicht mehr vorgenommen werden kann, der Anmelder also keinerlei Gegenleistung für die Prüfungsgebühr erhält. Zwar mag die Regelung in Art. 11 Buchst. a der Gebührenordnung des Europäischen Patentamts für eine europäische Patentanmeldung, die vorsieht, dass die Prüfungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet wird, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, sachgerechter erscheinen. Die gesetzliche Regelung ist jedoch der Beurteilung zugrunde zu legen, da verfassungsrechtliche Bedenken gegen ihre Wirksamkeit nicht bestehen.
Gebühren sind öffentlichrechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken. Innerhalb seiner jeweiligen Regelungskompetenz verfügt der Gebührengesetzgeber aus der Sicht des Grundgesetzes über einen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum. Materiellverfassungsrechtliche Grenzen einer Gebührenregelung können sich aus den Grundrechten ergeben, insbesondere aus dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) sowie aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dabei sind alle mit einer Gebührenregelung verfolgten, verfassungsrechtlich zulässigen Zwecke als Abwägungsfaktoren in die Verhältnismäßigkeitsbetrachtung einzubeziehen. Aus Art. 3 Abs. 1 GG folgt, dass Gebühren nicht völlig unabhängig von den Kosten der gebührenpflichtigen Staatsleistung festgesetzt werden dürfen und dass die Verknüpfung zwischen den Kosten der staatlichen Leistung und den dafür auferlegten Gebühren sich nicht in einer Weise gestaltet, die sich, bezogen auf den Zweck der gänzlichen oder teilweisen Kostendeckung, unter keinem vernünftigen Gesichtspunkt als sachgemäß erweist. Darüber hinaus gebietet der Gleichheitsgrundsatz, bei gleichartig beschaffenen Leistungen die Gebührenmaßstäbe und sätze in den Grenzen der Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit so zu wählen und zu staffeln, dass sie unterschiedlichen Ausmaßen in der erbrachten Leistung Rechnung tragen. Diese Grundsätze gelten auch für die Bemessung von Gebühren zur Abdeckung von Gerichtskosten. Danach muss der Gesetzgeber die Auswahl der gleich oder ungleich zu behandelnden Sachverhalte sachgerecht treffen. Nach Maßgabe dieser Grundsätze wäre es verfassungsrechtlich nicht hinzunehmen, wenn eine Gebühr ohne Rückzahlungsmöglichkeit auch dann verfällt, wenn es aus Gründen, die ganz überwiegend im Verantwortungsbereich der Behörde liegen, an einer Gegenleistung der Behörde völlig fehlt.
Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor, weshalb es nicht zu beanstanden ist, dass eine bereits gezahlte Prüfungsgebühr nicht erstattet wird, obwohl eine Prüfung unterbleibt, weil die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in solchen Fällen bereit und in der Lage ist, die Leistung, die mit der Gebühr abgegolten werden sollte, zu erbringen, und daran durch ein Verhalten des Anmelders – hier die Inanspruchnahme der Priorität der Patentanmeldung für eine spätere Anmeldung – gehindert wird. Hinzu kommt, dass der Anmelder weder den Prüfungsantrag zeitgleich mit der Einreichung der Patentanmeldung stellen muss noch gezwungen ist, die Prüfungsgebühr bereits mit der Stellung des Prüfungsantrags zu begleichen. Mit der Stellung des Prüfungsantrags kann er etwa zuwarten, bis die Prüfung der Anmeldung auf offensichtliche Mängel nach § 42 PatG abgeschlossen ist. Ihm ist zudem nach § 44 Abs. 1 Satz 2 PatG eine Zahlungsfrist von drei Monaten eingeräumt. Dies verschafft dem Anmelder die Möglichkeit, den Prüfungsantrag erst dann zu stellen oder die Prüfungsgebühr erst dann zu zahlen, wenn abzusehen ist, dass eine Prüfung der Anmeldung nach § 44 Abs. 1 PatG erforderlich wird. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Gesetzgeber mit dieser gesetzlichen Regelung in zulässiger Weise den Zweck verfolgt, die Anzahl der Erstattungsvorgänge gering zu halten und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu verringern.
Eine Auslegung von § 10 PatKostG dahin, dass auch eine bereits entrichtete Prüfungsgebühr zu erstatten ist, wenn die Patentanmeldung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, ist mithin nicht verfassungsrechtlich geboten.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 6. Mai 2014 – X ZB 11/13