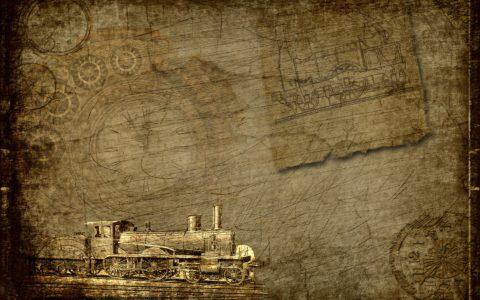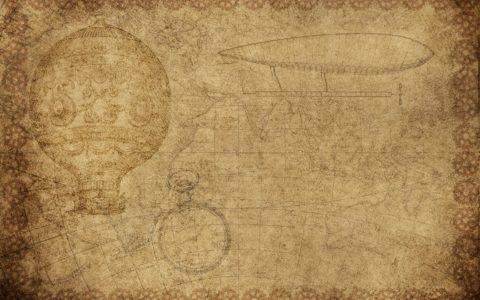Fachhochschulen sind keine wissenschaftlichen Hochschulen im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO.

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO findet die Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erst nach dem Erwerb der technischen Befähigung statt, die auch eine der Voraussetzungen für die Zulassung als Patentanwalt nach § 5 PatAnwO ist. Die technische Befähigung hat nach § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO erworben, wer sich im Geltungsbereich der Patentanwaltsordnung als ordentlicher Studierender einer wissenschaftlichen Hochschule dem Studium naturwissenschaftlicher oder technischer Fächer gewidmetund dieses Studium durch eine staatliche oder akademische Prüfung mit Erfolg abgeschlossen hat. Die derart erlangten und nachgewiesenen naturwissenschaftlichen und technischen Kenntnisse bilden die Grundlage für die Ausübung des Berufs eines Patentanwalts. Im Zusammenwirken mit den erforderlichen Rechtskenntnissen befähigen sie den Patentanwalt, sich im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in den Dienst der Rechtspflege zu stellen.
Wissenschaftliche Hochschulen im Sinne des § 6 PatAnwO sind alle Universitäten und ihnen gleichgestellte Hochschulen wie technische und landwirtschaftliche Hochschulen oder Bergakademien. Fachhochschulen fallen nicht darunter.
Nicht beantwortet werden muss die Frage, ob Fachhochschulen schon aus den Erwägungen des Oberlandesgerichts zum patentrechtlichen Begriff des Durchschnittsfachmanns als wissenschaftliche Hochschulen im Sinn des § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO ausscheiden. Zutreffend führt das Oberlandesgericht zwar aus, dass die Aufgaben und Tätigkeiten des Patentanwalts im Bereich der technischen Schutzrechte in weitem Umfang die Beurteilung des Verständnisses eines (Durchschnitts)Fachmanns erfordern. So gilt beispielsweise eine Erfindung nach Art. 56 EPÜ oder § 4 PatG als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Ob für die Fähigkeit zur Beurteilung solcher Rechtsfragen entscheidend ist, dass der Patentanwalt über eine Hochschulbildung verfügt, die über diejenige des Durchschnittsfachmanns hinausgeht, begegnet jedoch Bedenken, weil unberücksichtigt bleibt, dass die gesetzlich geforderte technische Befähigung des Patentanwalts nicht in jedem Einzelfall über der des maßgeblichen Fachmanns liegen muss.
Die Beschränkung auf Universitäten und ihnen im vorgenannten Sinne gleichgestellte Hochschule folgt aber aus der Entstehungsgeschichte und dem Sinn und Zweck der Zugangsbeschränkung.
Der Begriff der “wissenschaftlichen Hochschule” ist mit der Patentanwaltsordnung vom 07.09.1966 in die Regelung zur technischen Befähigung nach § 6 PatAnwO aufgenommen worden. Bis dahin war im Zulassungsrecht der Patentanwälte die ausdrückliche Aufzählung der Universitäten, technischen Hochschulen und Bergakademien in § 4 des Patentanwaltsgesetzes vom 28.09.1933 und der Vorgängerregelung in § 3 des Gesetzes betreffend die Patentanwälte vom 21.05.1900 maßgeblich. Nach dem bis 1966 geltenden Berufsrecht zählten die damaligen Vorgänger der späteren Fachhochschulen (Polytechnika, Ingenieurschulen) nicht zu den Einrichtungen, an denen die technische Befähigung zum Patentanwalt zu erlangen war. Der Grund dafür war, dass der Patentanwalt nicht nur die erforderlichen technischen Kenntnisse, sondern auch auf Grund seiner Ausbildung die Fähigkeit besitzen sollte, der weiteren Entwicklung der Technik zu folgen, mit dem notwendigen Überblick zu beraten sowie den Kern von Erfindungen zu erfassen, und zwar vor dem Hintergrund der Vielzahl der dabei betroffenen Fachgebiete und Aufgaben.
Mit dem 1966 in die Patentanwaltsordnung eingeführten Begriff der “wissenschaftlichen Hochschulen” hat der Gesetzgeber an die Stelle der Aufzählung wissenschaftlicher Einrichtungen eine am früheren Regelungsgehalt orientierte abstrakte Formulierung gesetzt. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass nicht jede Hochschule den besonderen Erfordernissen genügt. Dass der Gesetzgeber die Qualifikation der zu diesem Zeitpunkt bestehenden unterschiedlichen Hochschulen mit Blick auf ihre Eignung, die wissenschaftlichtechnischen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Ausbildung zum Patentanwalt und die Ausübung dieses Berufs zu vermitteln, durch die Neuregelung in § 6 PatAnwO grundsätzlich ändern wollte, ist nicht ersichtlich. Hätte der Gesetzgeber den Berufszugang auch Absolventen von Polytechnika, Ingenieur- oder Fachhochschulen eröffnen wollen, hätte er den Kreis der geeigneten Hochschulen nicht durch das Wort “wissenschaftlich” eingeschränkt. Ein Hochschulstudium technischer Fächer sollte deshalb weiterhin nur genügen, wenn es an einer wissenschaftlichen Hochschule erfolgt war.
Demzufolge ist der Begriff der “wissenschaftlichen Hochschule” in § 6 PatAnwO in der Folgezeit stets dahin verstanden worden, dass damit alle Universitäten, technischen und landwirtschaftlichen Hochschulen sowie Bergakademien zusammengefasst sind, die Hochschulcharakter im Sinne der Hochschulverfassung der Bundesrepublik Deutschland haben. Fachhochschulen waren danach im Anwendungsbereich der Patentanwaltsordnung nicht als wissenschaftliche Hochschulen anzusehen, weil diese sich hinsichtlich ihrer gesetzlich vorgegebenen Aufgaben und Zielsetzungen von jenen unterschieden. Während die wissenschaftlichen Hochschulen nach der damaligen Hochschulordnung eine umfassende vertiefte wissenschaftliche Ausbildung vermitteln sollten, die den Studenten befähigte, einen Beruf seiner Wahl auszuüben, lag der Schwerpunkt der Ausbildung an den Fachhochschulen auf der Vorbereitung für eine bestimmte berufliche Tätigkeit, deren Ausübung (lediglich) die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erforderte. Diese eher praktische und nicht wissenschaftliche Ausrichtung der Fachhochschulen hatte zur Folge, dass nicht bereits mit dem erfolgreichen Abschluss eines technischen oder naturwissenschaftlichen Studiums an einer Fachhochschule, sondern erst mit dem Abschluss eines solchen Studiums an einer wissenschaftlichen Hochschule, wie etwa einer Universität oder einer technischen Hochschule, die technische Befähigung für die Zulassung zum Beruf eines Patentanwalts erworben wurde.
Diese Auslegung entspricht dem unverändert fortgeltenden Sinn der Zulassungsbeschränkung, eine hohe Qualität der Dienste des Patentanwalts insbesondere im Interesse der Rechtsuchenden zu gewährleisten. Die dabei zu stellenden Anforderungen sind dadurch geprägt, dass der Patentanwalt zu einer abstrahierenden Erfassung an ihn herangetragener Erfindungen in der Lage sein muss, deren Gehalt mit möglichst weitreichend zu formulierenden Patent- oder Gebrauchsmusteransprüchen zu schützen ist, also hinter dem einzelnen das Grundsätzliche zu erfassen, ohne dabei die Erteilung oder den Rechtsbestand des Schutzrechts zu gefährden. Dies verlangt vom Patentanwalt in besonderem Maße Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit zur selbständigen, systematischen und antizipierenden Vertiefung in ihm oft unbekannte technische und im Übrigen rechtliche Zusammenhänge.
An diesem Verständnis des Rechtsbegriffs der wissenschaftlichen Hochschule in § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO hat die Fortentwicklung der Hochschulverfassung im Zuge des sogenannten BolognaProzesses nichts geändert.
Die Hochschulverfassung hat allerdings in den vergangenen Jahren Änderungen unter anderem dadurch erfahren, dass der Bundes- und die Landesgesetzgeber Universitäten und Fachhochschulen in mancher Hinsicht einander angenähert haben. Das Hochschulrahmengesetz und die Landeshochschulgesetze unterscheiden grundsätzlich nicht mehr zwischen solchen Regelungen, die allein für Universitäten Geltung beanspruchen, und solchen Regelungen, die auf andere Hochschularten anwendbar sind, wie aus § 1 Satz 1 HRG und den Vorschriften des Landesrechts hervorgeht. Die wesentlichen Aufgaben und Bildungsziele werden vielmehr für alle Hochschularten einheitlich festgelegt, die Freiheit von Forschung und Lehre wird auch für Fachhochschulen garantiert und auch den Fachhochschulen sind Forschungsaufgaben übertragen worden. Danach kann es auch Aufgabe einer Fachhochschule sein, ihren Studierenden wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden zu vermitteln sowie sie zu wissenschaftlicher Arbeit zu befähigen. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts lässt sich ein Wille des Gesetzgebers, dass neben Universitäten auch Fachhochschulen als wissenschaftliche Ausbildungsstätten angesehen werden sollen, auch darin erkennen, dass alle Hochschulen nach § 19 Abs. 1 HRG Studiengänge einrichten können, die bei einheitlicher Regelstudienzeit zu einem Bachelor oder Bakkalaureusgrad und zu einem Master- oder Magistergrad führen.
Eine umfassende rechtliche Gleichsetzung der Universitäten und technischen Hochschulen einerseits und der Fachhochschulen andererseits sowie der dort jeweils angebotenen Bachelor- und Masterstudiengänge (zu Diplomstudiengängen vgl. ferner § 18 Abs. 1 HRG) folgt daraus indessen nicht. Den einschlägigen bundesrechtlichen Regelungen ist sie schon deshalb nicht zu entnehmen, weil diese auf der – inzwischen abgeschafften – Rahmengesetzgebungskompetenz nach Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a GG a.F. beruhen. Die abgesehen von den Fragen der Hochschulzulassung und der Hochschulabschlüsse (vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 GG) allein maßgeblichen Gesetze der Länder füllen die im Grundsatz identischen Anforderungen an die verschiedenen Hochschularten mit unterschiedlichen Inhalten aus. So weist etwa das baden-württembergische Landesrecht in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BWLHG (im Wesentlichen übereinstimmend mit dem bayerischen Landesrecht in Art. 2 Abs. 1 Satz 6 BayHSchG) den Fachhochschulen die Aufgabe zu, durch anwendungsbezogene Lehre und Weiterbildung eine Ausbildung zu vermitteln, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt; im Rahmen ihrer Aufgaben sollen sie anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung betreiben. Den Universitäten hingegen obliegt nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BWLHG in der Verbindung von Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung die Pflege und Entwicklung der Wissenschaften. Nach Art. 2 Abs. 1 Satz 4 BayHSchG dienen Universitäten vornehmlich der Forschung und Lehre und verbinden diese zu einer vorwiegend wissenschaftsbezogenen Ausbildung. Ähnliche Bestimmungen treffen die Gesetze anderer Länder (vgl. etwa § 5 Abs. 1 SächsHSFG; § 3 Abs. 1, 2 NWHG; § 2 Abs. 1 Satz 3, 4 RPHochSchG; § 4 Abs. 3 Satz 3, 4 BerlHG).
Ungeachtet der durch die geschilderte Rechtsentwicklung ausgelösten Annäherung von Universitäten und Fachhochschulen bleibt danach eine stärker an der wissenschaftlichen eigenständigen Vertiefung und Methodik orientierte Ausrichtung des Universitätsstudiums im Vergleich zur mehr auf die praktischen Anwendung im Beruf ausgerichteten Ausbildung an der Fachhochschule bestehen. Einer Unterscheidung zwischen den wissenschaftlichen Hochschulen und den sonstigen Hochschulen im Rahmen der Regelung der technischen Befähigung zum Patentanwalt ist somit nicht die Grundlage entzogen. Denn auch nach der Umgestaltung des Hochschulrechts unterscheidet sich der Inhalt eines Studiums an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule von dem eines Studiums an einer Fachhochschule.
Maßgeblich für die Auslegung des Begriffs der wissenschaftlichen Hochschule in § 6 PatAnwO und seine Anwendung in der heutigen Hochschullandschaft ist letztlich der in seinem Regelungszusammenhang zu sehende; vom Normgeber festgelegte Sinn und Zweck der Vorschrift. Dass insoweit das Studium an einer Fachhochschule auf Grund der jüngeren rechtlichen und tatsächlichen Entwicklungen in der Regel heute dieselben; vom Gesetzgeber mit dem Zusatz “wissenschaftlich” bewusst geforderten Fähigkeiten wie dasjenige an einer Universität oder ihr gleichgestellten technischen Hochschule garantiert, ist nicht ersichtlich. Unter dem Gesichtspunkt der technischen Befähigung zum Patentanwalt ist eine Differenzierung zwischen solchen Hochschulen, deren Aufgabe in besonderem Ausmaß in der Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte liegt, und Fachhochschulen, deren Zielsetzung in größerem Ausmaß in der praktischen Vorbereitung für eine bestimmte berufliche Tätigkeit liegt, weiterhin geboten. Nicht entscheidend ist demgegenüber, dass nach den Hochschulgesetzen der Länder auch Fachhochschulabsolventen die Zulassungsvoraussetzungen für den Beginn eines (wissenschaftlichen) Promotionsstudiums an einer Universität erfüllen können.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14.04.2010 (BVerfG, aaO) steht hierzu nicht in Widerspruch. Sie bejaht die Frage, ob die Tätigkeit des Fachhochschullehrers unter den Schutz der Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG fällt, befasst sich aber nicht damit, in welchem Ausmaß sich auch heute das Studium an einer Universität von dem an einer Fachhochschule zumindest unter dem Aspekt der Gewichtung wissenschaftlicher Inhalte und Methoden unterscheidet. Unter dem Gesichtspunkt des berufsrechtlichen Zulassungsrechts kommt es vielmehr entscheidend darauf an, ob ein Studium an einer Hochschule rechtlich und tatsächlich – bei der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise – eine für die patentanwaltliche Ausbildung und Berufspraxis hinreichend wissenschaftliche Befassung mit einem technischen Fach oder einer Naturwissenschaft und das Erlernen wissenschaftlicher Arbeitstechniken beim Umgang mit unbekannten Problemen und Materien garantiert.
Der Gesetzgeber hat auch an keiner Stelle, insbesondere nicht im Rahmen der Umgestaltung der Hochschulverfassung, zu erkennen gegeben, dass er die speziell für die Anforderungen des Patentanwaltsberufs geschaffenen Zulassungsvoraussetzungen mit Blick auf die Annährung von Universitäten und Fachhochschulen ändern wollte. Die Definition des Hochschulbegriffs in § 1 HRG hat der Gesetzgeber ausdrücklich auf “Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes” beschränkt. Dies legt die Annahme fern, er habe in jedem erdenklichen Zusammenhang sämtliche Hochschulformen gleichstellen wollen und lediglich übersehen, dass hierfür in § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO eine Anpassung des Gesetzeswortlauts angezeigt wäre.
Eine Fachhochschulen einbeziehende Auslegung des Begriffs der “wissenschaftlichen Hochschulen” im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO ist auch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht geboten.
Die nach Art. 5 Abs. 3 GG garantierte Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre ist nicht dadurch berührt, dass Absolventen einer Fachhochschule grundsätzlich keinen Zugang zum Beruf des Patentanwalts haben. Dem autonom auszulegenden Merkmal “wissenschaftlich” in § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO, das dem Schutz der Allgemeinheit und nicht der Ausprägung der Wissenschaftsfreiheit dient, muss nicht derselbe Inhalt beigelegt werden, wie dem der Wissenschaft in Art. 5 Abs. 3 GG. Im Übrigen wäre ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit aus den nachstehenden Gründen gerechtfertigt.
Die Zulassungsbeschränkung auf Universitätsabsolventen ist als Eingriff in die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) gerechtfertigt. Beschränkungen der Freiheit der Berufswahl durch subjektive Zulassungsvoraussetzungen sind statthaft, soweit dadurch ein überragendes Gemeinschaftsgut, das der Freiheit des Einzelnen vorgeht, geschützt werden soll. Außerdem muss die Beeinträchtigung der Berufsfreiheit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen und darf insbesondere für die Berufsträger keine unzumutbare Belastung darstellen. Die Bestimmungen über die technische Befähigung dienen der Sicherung einer hochwertigen Beratung der Rechtsuchenden sowie der Funktionsfähigkeit insbesondere des Patent- und Markenwesens und der Rechtspflege auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und damit überragend wichtigen Gemeinschaftsgütern 69/12, juris Rn. 13 m.w.N.; BVerfG, NJW 2008, 1212, 1213 m.w.N.)). Sie stehen auf Grund der bereits dargelegten Anforderungen an die patentanwaltliche Praxis nicht außer Verhältnis zu der erforderlichen Beeinträchtigung der Berufsfreiheit und stellen auch angesichts der Härten abmildernden Ausnahmeregelung in § 158 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PatAnwO keine unzumutbare Belastung für die Betroffenen dar.
Schließlich begegnet die nach der Art der Hochschule differenzierende Regelung in § 6 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO auch unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG auf Grund der verbleibenden und für die Befähigung zum Patentanwalt relevanten Unterschiede zwischen Universitäts- und Fachhochschulstudium keinen Bedenken.
Nach alledem ermöglichte der mit dem Grad eines “Master of Science” an der Fachhochschule K. abge- schlossene Studiengang der “Applied Physics” den Beginn der Ausbildung zum Patentanwalt nicht, weil er die Voraussetzungen für die technische Befähigung nach § 6 Abs. 1 PatAnwO nicht erfüllte.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 29. November 2013 – PatAnwZ 1/12