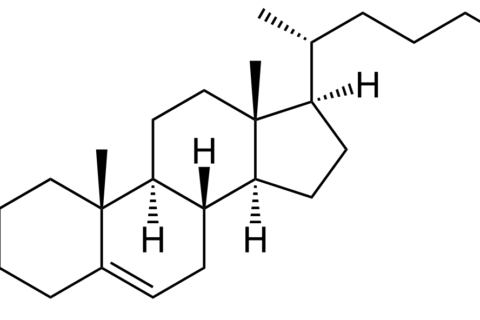Wer die Nichtigerklärung eines erloschenen Patents begehrt, kann sich nicht mehr auf das bei einem als Popularklage ausgestalteten Verfahren ein Rechtschutzbedürfnis rechtfertigende Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigerklärung berufen. Nichtigerklärung eines erloschenen Patents

Das Erfordernis des besonderen eigenen Rechtsschutzinteresses ist dabei jedoch nicht etwa so zu verstehen, dass an dieses Interesse besonders strenge, den Rechtsschutz einengende Anforderungen zu stellen wären. Es muss sich – gegenüber dem vor dem Erlöschen des Schutzrechts genügenden und ohne weiteres gegebenen allgemeinen Rechtsschutzinteresse – nunmehr lediglich um ein spezielles, in der Person des Klägers liegendes, aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbares Interesse handeln[1].
Dementsprechend geht der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung eines durch Verzicht erloschenen Patents ohne weiteres dann zu bejahen ist, wenn der beklagte Patentinhaber den Nichtigkeitskläger noch weiterhin wegen Verletzung des Streitpatents in der Zeit vor dem Erlöschen des Streitpatents in Anspruch nehmen kann, wobei weder die Erhebung einer Verletzungsklage noch die Ankündigung einer solchen verlangt wird[2].
Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Nichtigkeitsklage ist nicht nur dann zu bejahen, wenn der Kläger patentrechtlichen Ansprüchen im engeren Sinne, also Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen unmittelbar aus dem Streitpatent ausgesetzt ist.
Im Hinblick darauf, dass das Rechtsschutzbedürfnis nicht bereits bei einer aussichtslosen, sondern grundsätzlich nur bei einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung abgesprochen werden kann, kann auch in Bezug auf die im Streitfall in Rede stehenden, nicht unmittelbar aus dem Streitpatent selbst resultierenden Ansprüche, nicht entscheidend sein, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind. Hinreichender Anlass, den von staatlichen Einrichtungen gewährten Schutz in Anspruch zu nehmen, besteht vielmehr schon dann, wenn der Kläger Grund zu der Besorgnis hat, er könne derartigen Ansprüchen ausgesetzt werden.
Ebenso wenig wird das Rechtsschutzbedürfnis durch eine inzwischen gegebenenfalls eingetretene Verjährung der möglichen Regressansprüche beseitigt. Der Eintritt der Verjährung hat für sich genommen weder Auswirkungen auf das Bestehen noch auf die Durchsetzbarkeit eines Anspruchs. Der Schuldner ist ab dem Verjährungseintritt lediglich berechtigt, dauerhaft die Leistung zu verweigern (§ 214 Abs. 1 BGB). Ob er von der ihm zustehenden Einrede der Verjährung Gebrauch macht, steht in seinem freien Belieben[3]. Er kann durch einseitige Erklärung sogar auf die Einrede der Verjährung verzichten[4].
Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. Mai 2016 – X ZR 28/14
- BGH, Beschluss vom 12.03.1981 – X ZB 16/80, GRUR 1981, 515, 516 Anzeigegerät[↩]
- BGH, Urteil vom 26.06.1973 – X ZR 23/71, GRUR 1974, 146 Schraubennahtrohr; Beschluss vom 14.02.1995 – X ZB 19/94, GRUR 1995, 342, 343 Tafelförmige Elemente; Beschluss vom 12.03.1981 – X ZB 16/80, GRUR 1981, 515, 516 Anzeigegerät; Urteil vom 12.12 2006 – X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport; Urteil vom 08.07.2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 8 – Fälschungssicheres Dokument[↩]
- BGH, Urteil vom 27.01.2010 – VIII ZR 58/09, BGHZ 184, 128 Rn. 27 f.[↩]
- BGH, Urteil vom 18.09.2007 – XI ZR 447/06, WM 2007, 2206 Rn. 15[↩]