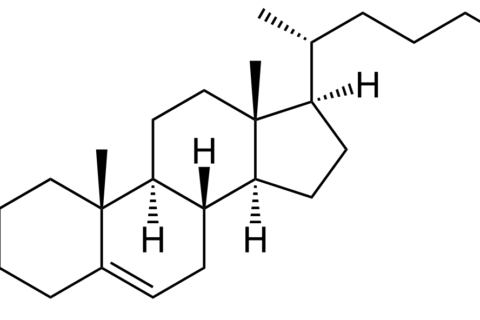Mit der Frage der Erschöpfung der Rechte aus dem Patent, wenn mit der angegriffenen Vorrichtung ein erwartbarer Ersatzbedarf gedeckt wird, hatte sich aktuell das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Rechtsstreit zu befassen, in dem es um Filtereinsätze für einen Ölfilter ging:

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent, das ein Erzeugnis betrifft, hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind[1]. Der rechtmäßige Erwerber eines solchen Exemplars ist befugt, dieses bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Exemplars ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von einer Wiederherstellung in diesem Sinne kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen nicht mehr die Identität des in Verkehr gebrachten Exemplars wahren, sondern darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen[2].
Die dem rechtmäßigen Erwerber eines geschützten Erzeugnisses zustehende Befugnis zur Benutzung und Weiterveräußerung beruht nicht auf einer vertraglichen Rechtseinräumung des Patentinhabers. Sie ist vielmehr Folge davon, dass die dem Patentinhaber nach § 9 PatG zustehenden Rechte mit dem Inverkehrbringen eines konkreten Exemplars insoweit erschöpft sind, der Patentinhaber hinsichtlich dieses Exemplars also seine Befugnis verloren hat, dem Abnehmer oder Dritten den bestimmungsgemäßen Gebrauch des geschützten Erzeugnisses zu verbieten. Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines solchen Exemplars stellt deshalb keine Patentverletzung dar – unabhängig davon, durch wen er erfolgt[3].
Zur Beurteilung der Frage, ob durch den Austausch von Teilen die Identität des bearbeiteten Gegenstandes gewahrt bleibt oder ob die Maßnahmen auf die erneute Herstellung des patentgeschützten Erzeugnisses hinauslaufen, bedarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits[4]. Die Grenze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs kann sachgerecht nicht ohne Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung festgelegt werden, die aus patentrechtlicher Sicht einerseits die Identität des Erzeugnisses prägen und andererseits Anhaltspunkte dafür liefern, inwieweit bei diesem Erzeugnis die einander widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem angemessenen Ausgleich des Schutzes bedürfen[5]. Dabei kann auch von Bedeutung sein, ob es sich um Teile handelt, mit deren Austausch während der Lebensdauer der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen ist, und inwieweit sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln[6].
Nach diesen Grundsätzen liegt eine Erschöpfung der Patentrechte im Streitfall nicht vor. Allerdings ist bei den von den Klagepatenten geschützten Flüssigkeitsfiltern damit zu rechnen, dass der Ringfiltereinsatz während der Lebensdauer des Filters mehrfach ausgetauscht wird. Das ergibt sich schon aus den Patenten selbst, die mit dem Ableitungskanal und der durch Rampe und Zapfen gebildeten Einführhilfe gerade diesen Austauschvorgang verbessern bzw. erleichtern sollen. Das entspricht auch der Verkehrauffassung; es ist bekannt, dass sich die eigentlichen Filterelemente durch die herausgefilterten Schmutzteilchen mit der Zeit zusetzen und daher regelmäßig ausgetauscht werden müssen.
In einem solchen Fall liegt in dem Austausch in der Regel keine Neuherstellung. Eine solche ist nur ausnahmsweise gegeben, und zwar dann, wenn sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln und deshalb durch den Austausch dieser Teile der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird. Die technischen Wirkungen der Erfindung treten in dem ausgetauschten Teil in Erscheinung, entweder wenn das Teil selbst wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens verkörpert, indem speziell dieses Teil aufgrund seiner Sacheigenschaften oder seiner Funktionsweise für die patentgemäßen Vorteile maßgeblich (mit-)verantwortlich ist, mithin einen entscheidenden Lösungsbeitrag für den Erfindungserfolg liefert, oder wenn gerade an oder in dem Austauschteil die Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung verwirklicht werden, mithin sich die Vorteile der Erfindung speziell im ausgetauschten Teil niederschlagen, etwa weil die Erfindung die Funktionsweise oder die Lebensdauer des Austauschteils beeinflusst[7].
Ein solcher Ausnahmefall ist hier gegeben. Die in beiden Klagepatenten geschützte, auf die Einführhilfe bezogene Erfindung setzt, wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, voraus, dass die im Filtergehäuse vorhandene Rampe und der Ringfiltereinsatz angeformte Zapfen in einer spezifischen Weise aufeinander abgestimmt sind, um das angestrebte Leistungsergebnis, nämlich ein Abgleiten des Zapfens auf der Rampe bis zum Erreichen der Öffnung des Ableitungskanals, zu erreichen; durch diese Abstimmung von Zapfen und Rampe wird ein „blindes“ Einführen des Ringfiltereinsatzes, bei dem es auf die genaue Position des Zapfens nicht ankommt, erst ermöglicht. Der Erfindungsgedanke lässt sich nur erreichen, wenn Zapfen und Rampe „zueinander passen“, also die richtige radiale Position und Kontaktflächen haben, die das Abgleiten des Zapfens beim Eindrehen des Ringfiltereinsatzes zulassen. Weiter müssen nach beiden Klagepatenten der Ringfiltereinsatz und das Filtergehäuse so aneinander angepasst sein, dass der Ringfiltereinsatz im Filtergehäuse frei drehbar ist, solange der Zapfen noch nicht die Öffnung des Ableitungskanals eingreift. Das setzt weitere Abstimmungen zwischen Ringfiltereinsatz und Filtergehäuse voraus, die über die Anpassung von Rampe und Zapfen hinausgehen. Das betrifft z.B. die Gestaltung des zentralen Bereichs, in dem der Ringfiltereinsatz mit dem Filtergehäuse bzw. mit dem Funktionsträgereinsatz verbunden wird und der bei der genannten Drehung die „Achse“ bildet, sowie weitere Teile wie etwa die Außenform des Ringfiltereinsatz und die Innenform des Filteraufnahmeraums im Filtergehäuse.
Damit verkörpert sich die Erfindung notwendig nicht nur im Filtergehäuse bzw. im Funktionsträgereinsatz, sondern auch am Ringfiltereinsatz mit seinem angeformten Zapfen. Seine Ausgestaltung soll (zusammen mit der entsprechenden Ausgestaltung des Filtergehäuses bzw. Funktionsträgereinsatzes) gerade den Austauschvorgang verbessern bzw. erleichtern. Die Würdigung des Landgerichts, der Ringfiltereinsatz sei bloßes Objekt des verbesserten Einsetzvorgangs und trage zum Leistungsergebnis der Erfindung nichts bei[8], vermag das Oberlandesgericht daher nicht zu teilen. Der verbesserte Einführvorgang wird nach der Lehre beider Klagepatente auch durch körperliche Merkmale des Ringfiltereinsatzes erreicht, nämlich durch die funktionsorientierte Anpassung des Zapfens an die im Filtergehäuse vorhandene Rampe sowie durch die weitere Abstimmung des Ringfiltereinsatzes und des Filtergehäuses.
Dass Ringfiltereinsätze mit angeformtem exzentrischen Zapfen, der den Ableitungskanal im Einbauzustand verschließt, bereits aus dem in den Klagepatenten zitierten Stand der Technik bekannt waren, ändert an diesem Ergebnis nichts. Zentraler Erfindungsgedanke ist die Erleichterung des Einsetzvorgangs, die gegenüber diesem Stand der Technik durch die Rampe, den auf sie abgestimmten Zapfen und durch die weitere Anpassung von Ringfiltereinsatz und Filtergehäuse erreicht wird und die bewirkt, dass es auf die relative Winkelposition (in Drehrichtung) von Ringfiltereinsatz und Filtergehäuse nicht mehr ankommt. Diese spezifische Ausgestaltung des Ringfiltereinsatzes wird durch den genannten Stand der Technik gerade nicht offenbart.
Wegen der anspruchsgemäßen wechselseitigen Anpassung von Ringfiltereinsatz und Filtergehäuse /Funktionsträgereinsatz wird der Ringfiltereinsatz in seiner Funktion durch die Lehre der Klagepatente maßgeblich beeinflusst[9]. Anders als in der oben zitierten Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf[10] ist der auszutauschende Teil der Vorrichtung (Ringfiltereinsatz) zentraler Bestandteil der unter Schutz gestellten technischen Lehre; er steht insoweit gleichwertig neben den anderen, auf das Filtergehäuse bzw. den Funktionsträgereinsatz bezogenen Teilen der Erfindung. Bei der wertenden Betrachtung im Rahmen der zu treffenden Interessenabwägung entspricht der Streitfall demjenigen, der der Entscheidung „Flügelradzähler“ des Bundesgerichtshofs[11] zugrundelag; dort wirkte die austauschbare Messkapsel eines Flügelradzählers zur Erfassung der Durchflussmenge von Flüssigkeiten mit dem erfindungsgemäßen Gehäuse des Zählers so zusammen, dass das in der Messkapsel enthaltene Flügelrad gleichmäßig und wirbelfrei beaufschlagt und deshalb die Gefahr eines Aneinanderfestbackens von Messkapsel und Gehäuse verringert wurde[12]. Ganz entsprechend wird auch hier das von der beanspruchten Erfindung angestrebte Leistungsergebnis erst durch das Zusammenwirken der anspruchsgemäß aufeinander abgestimmten Teile von Ringfiltereinsatz und Gehäuse/Funktionsträgereinsatz erreicht.
Im Ergebnis liegt also im Austausch des Ringfiltereinsatzes eine Neuherstellung des von der Erfindung geschützten Gegenstandes. Damit ist die mittelbare Benutzung der geschützten Lehre nicht wegen insoweit bestehender Erschöpfung der Patentrechte gerechtfertigt. Auf die von den Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht diskutierte Frage, ob in die Ölfilter YY auch andere, nicht patentgemäße Ringfiltereinsätze eingebaut werden können, kommt es nach Auffassung des Oberlandesgerichts nicht an. Die durch den Einbau des angegriffenen, mittelbar patentverletzenden Ringfiltereinsatzes bewirkte Neuherstellung der geschützten Vorrichtung ist nach dem Ausgeführten vom Ausschließlichkeitsrecht der Klagepatente umfasst.
Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 23. Juli 2014 – 6 U 89/13
- vgl. BGHZ 143, 268, 270 f. = GRUR 2000, 299 – Karate; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 27 – Pipettensystem[↩]
- BGHZ 159, 76, 89 = GRUR 2004, 758, 762 – Flügelradzähler; BGH GRUR 2006, 837 16 – Laufkranz; BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 27 – Pipettensystem; BGH GRUR 2012, 1118 18 – Palettenbehälter II[↩]
- BGH a.a.O. Rn.20 – Palettenbehälter II[↩]
- BGH a.a.O. Rn. 26 m.w.N. – Palettenbehälter II[↩]
- BGHZ 171, 167 28 – Pipettensystem[↩]
- BGH GRUR 2012, 1118 23, 28 – Palettenbehälter II; BGH GRUR 2004, 758, 762 – Flügelradzähler[↩]
- OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 185 116 m.w.N. – Nespressokapseln[↩]
- vgl. dazu BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 31 – Pipettensystem[↩]
- vgl. dazu BGH GRUR 2006, 837 22 – Laufkranz[↩]
- GRUR-RR 2013, 185 119 ff. – Nespressokapseln[↩]
- BGHZ 159, 76, 92 f. = GRUR 2004, 758, 762 f.[↩]
- vgl. auch BGH GRUR 2012, 1118 44 – Palettenbehälter II[↩]