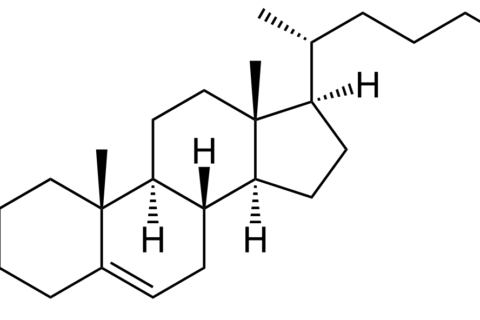Ein Patentanspruch, der eine neue Verwendung eines Medikaments betrifft, hat die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft zum Gegenstand. Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz, wie ihn § 3 Abs. 4 PatG und Art. 54 Abs. 5 EPÜ nunmehr auch für weitere Indikationen ausdrücklich vorsehen, und zwar unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist.

Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung wird nicht nur durch die zu behandelnde Krankheit und die Dosierung bestimmt, sondern auch durch sonstige Parameter, die auf die Wirkung des Stoffs Einfluss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeutung sein können.
Wegen § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG können therapiebezogene Anweisungen nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln.
Die Anweisung, einen Körperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhigzustellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, ist nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt, weil es am Prioritätstag bekannt war, dass Komplikationen, die einige Tage nach der Behandlung auftreten, durch Ruhigstellen behandelt werden können.
Bei der Prüfung, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Repertoire gehörten.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 25. Februar 2014 – X ZB 5/13 und X ZB 6/13